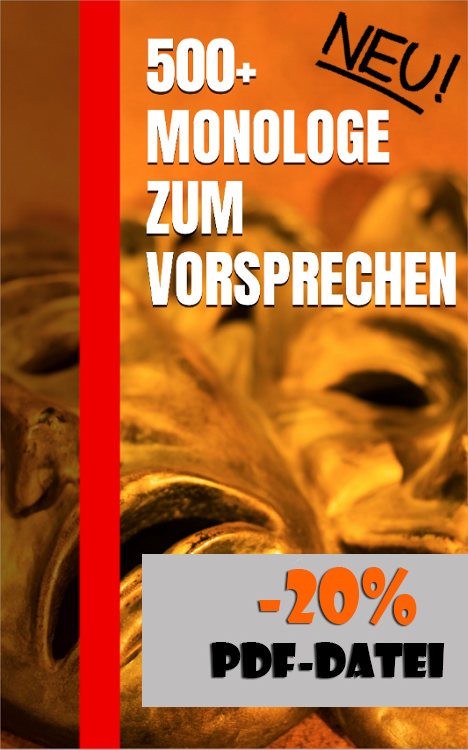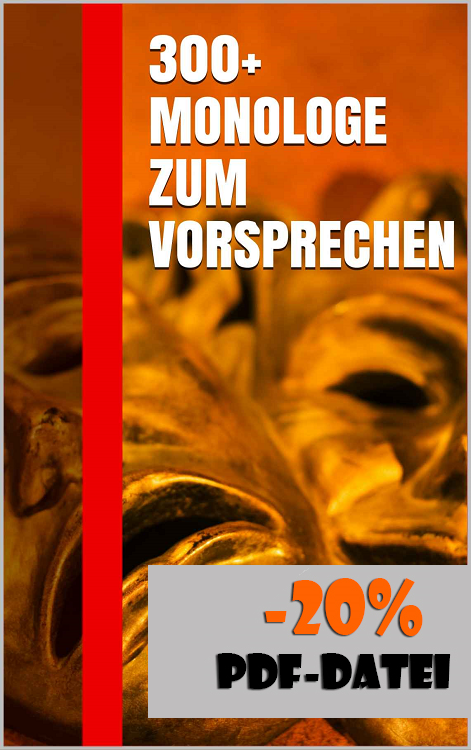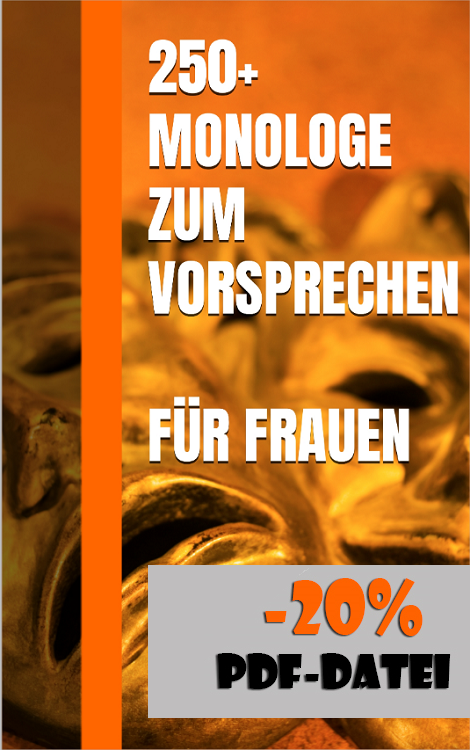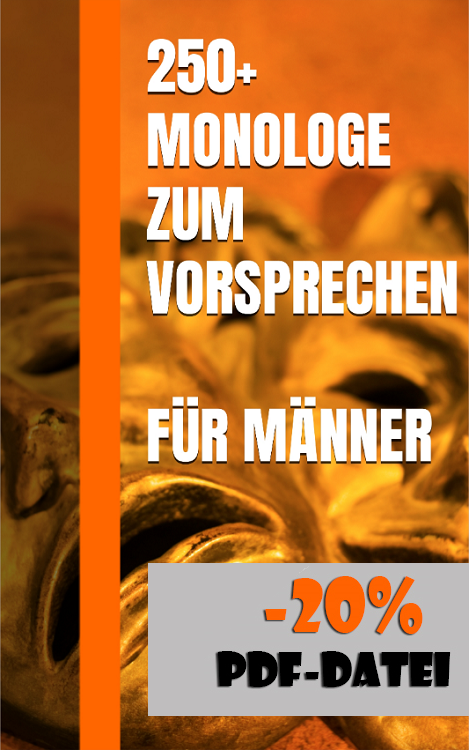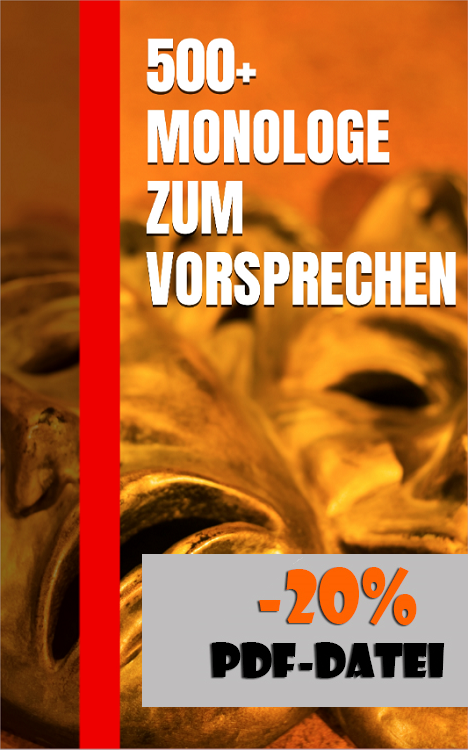Bewertung und Kritik zu
DER SCHNEESTURM
nach Vladimir Sorokin
Regie: Kirill Serebrennikov
Premiere: 16. August 2025 (Perner-Insel, Hallein)
Salzburger Festspiele
Deutschland-Premiere: 12. September 2025 (Übernahme ins Repertoire)
Düsseldorfer Schauspielhaus
Zum Inhalt: Nach seinem Titel gefragt, gibt der Autor eine Antwort, die in die Zukunft führt. „Ich liebe den Schnee. Der Schnee bedeckt die Erde und alles wird schön. Da sind die Verwerfungen, all die Widersprüche des Alltags und dann schneit es und die Welt ist schön“, sagt Vladimir Sorokin im Gespräch über seinen Roman, der wie bei Puschkin und Tolstoi den Titel Метель (Schneesturm) trägt und auf den ersten Blick ein Kondensat, ein Intertext der russischen Schneesturmtradition zu sein scheint. „Wenn Sie unterwegs sind und in einen Schneesturm geraten, war es das. Es ist ein schönes Phänomen, aber auch ein schreckliches, schicksalhaftes Ereignis. Meine Erzählung hat in Wahrheit drei Protagonisten: den Arzt, seinen Kutscher und den Schneesturm. Am Ende siegt der dritte.“
Wie die Schönheit des Schnees ist auch die Sprache des 19. Jahrhunderts, in der Sorokin erzählt, eine Täuschung. Der hellsichtige Visionär führt uns mit Referenzraum, Personal und Erzählsound zunächst in die Irre. Die postapokalyptische Odyssee des Arztes Garin, der einen Impfstoff in eine abgelegene Ortschaft bringen will, wo eine mysteriöse Seuche die Bewohner·innen in Zombies verwandelt, spielt in der Zukunft.

 TICKETS ONLINE KAUFEN
TICKETS ONLINE KAUFEN