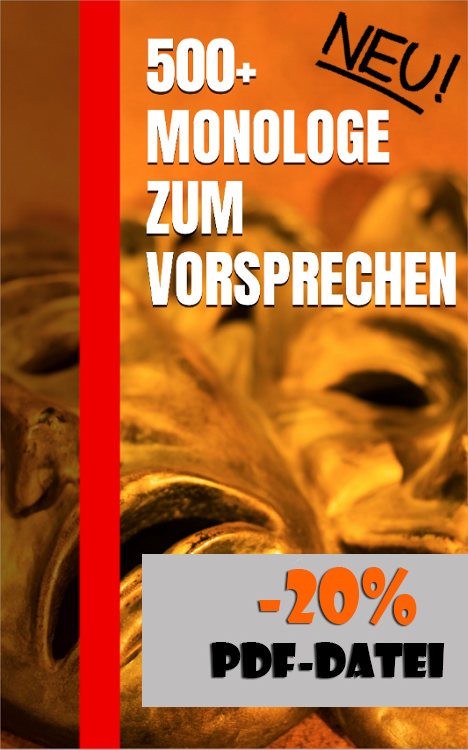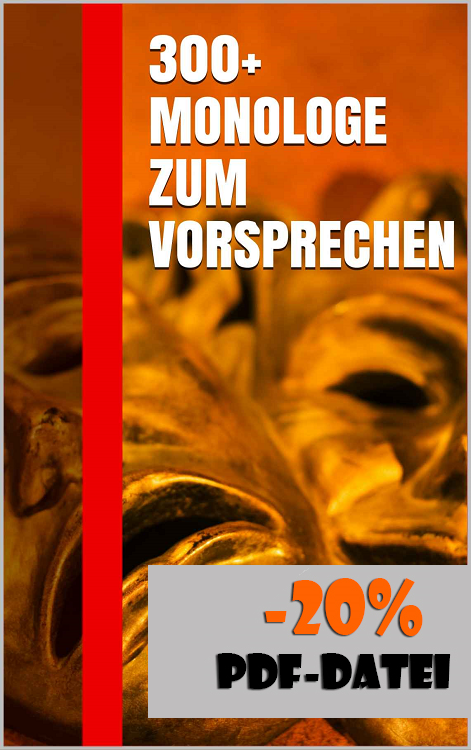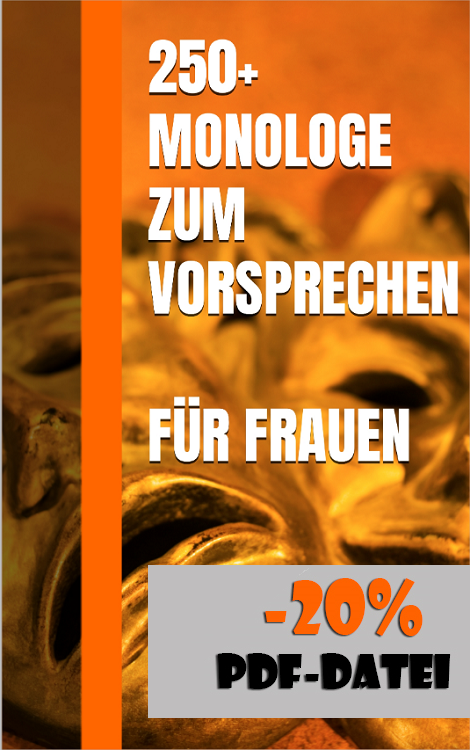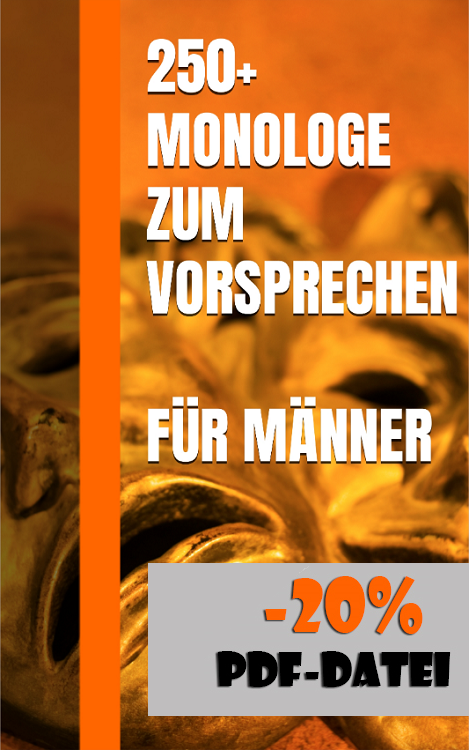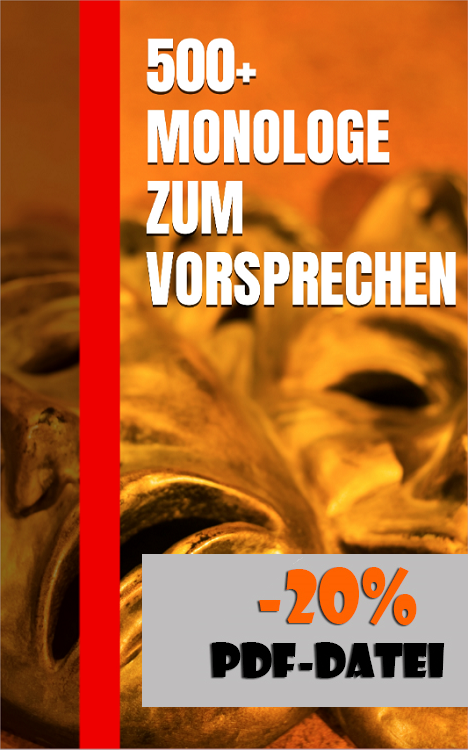Bewertung und Kritik zu
NATHAN DER WEISE
von Gotthold Ephraim Lessing
Regie: Ulrich Rasche
Premiere: 28. Juli 2023
Salzburger Festspiele
Eingeladen zum 61. Berliner Theatertreffen (2024)
Zum Inhalt: Nathan der Weise, Lessings letztes und mit Sicherheit berühmtestes Stück, ist die Geschichte eines Scheiterns. In einer von Ab- und Ausgrenzungen bestimmten Gesellschaft im Kriegszustand, dem Jerusalem des Dritten Kreuzzugs, wird ein reicher jüdischer Kaufmann vor den Sultan gerufen, der dringend seine Kriegskasse auffüllen muss. Um festzustellen, ob Nathan dem muslimischen Kriegsherrn „freiwillig“ Geld zu leihen bereit ist oder ob man ihm sein „Gut und Blut“ mit Gewalt nehmen muss, legt ihm der Herrscher die Frage vor, welche der drei monotheistischen Religionen die „wahre“ sei. Nathan antwortet mit der berühmten Parabel von den drei Ringen, mit denen ein unschlüssiger Vater seine drei Söhne unabhängig voneinander als den ihm liebsten auszeichnet. Die Pointe des „Märchens“ besteht darin, dass wohl keiner der drei Ringe der echte, „wahre“ ist. Alle drei Religionen sind in diesem einen Punkt ununterscheidbar — in ihrer Entfernung von und ihrem Streben nach der Wahrheit. Die Geschichte ist ein Erfolg und der Sultan tief beeindruckt. Nathan „darf“ ihm daraufhin den zur Fortführung des Krieges dringend benötigten Kredit anbieten.
Die Erfahrung, die Nathan im weiteren Verlauf macht, ist allerdings eine andere. Im Konflikt um seine christlich getaufte und von ihm jüdisch erzogene Ziehtochter Recha vermitteln nicht Toleranz und gegenseitige Anerkennung zwischen den Ansprüchen der verschiedenen Religionen. Vielmehr müssen zufällige familiäre Verbindungen zwischen ihr, dem christlichen Tempelherrn und dem muslimischen Sultan für Versöhnung sorgen. Es ist keine Menschheitsfamilie, die sich da findet, denn der Jude gehört (wieder einmal) nicht dazu. Was die komplizierte Familienzusammenführung allerdings mit sich bringt, ist eine fundamentale Verunsicherung der Identitäten: Kaum eine der Hauptfiguren ist am Ende des Stückes noch die, die sie am Beginn zu sein glaubte. Diese Unsicherheit enthält ein starkes Argument gegen die nun als zufällig ausgewiesenen Ab- und Ausgrenzungen des Anfangs. Es hilft aber Nathan offensichtlich nicht, dessen Erzählung von den drei Ringen im Verlauf des Dramas ohne weitere Folgen bleibt.
Regie und Bühne: Ulrich Rasche
Komposition: Nico van Wersch
Kostüme: Sara Schwartz
Chorleitung: Toni Jessen
Licht: Alon Cohen
Sounddesign: Raimund Hornich
Mitarbeit Bühne: Manuel La Casta
Dramaturgie: Sebastian Huber