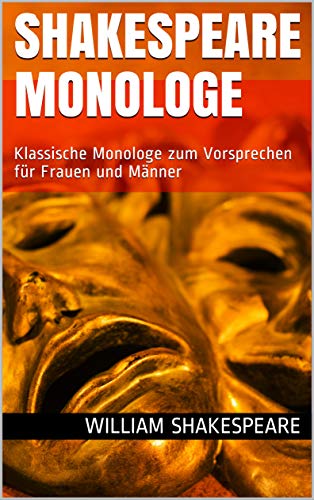Kritik
Albert Ostermeier zeichnet in seinem „Superspreader“-Monolog das Bild eines skrupellosen Agenten des Neoliberalismus. Küchenpsychologisch-klischeehaft erklärt uns die Figur auch selbst, wie sie zu dem wurde, was sie ist: vom Vater missbraucht, von der Mutter nie geliebt, strebt das gekränkte Kind nach Anerkennung und Rache.
Florian Jahr aus dem Resi-Ensemble spielt das Delirium des Marcel als Solo vor der Zoom-Kamera für 15 Zuschauer*innen oder Pärchen vor den heimischen Bildschirmen. Schwitzend steigert er sich in Assoziationsketten hinein, die in der Corona-Gegenwart landen. Auch wenn die Pandemie nie beim Namen genannt wird, schleudert uns Jahr doch die bekannten Schlagwörter entgegen, die dieses Jahr prägten: die Wildtiermärkte wie in Wuhan, wo das Virus vermutlich auf den Menschen übersprang, die Schlachthöfe wie von Tönnies, in denen sich im Sommer Hotspots bildeten, als sich die Dumpinglohn-Leiharbeiter ansteckten, schließlich die Intensivstationen. Ostermeiers Botschaft ist klar: Die Gier und der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, sind gefährliche Pandemie-Treiber.
Marcel träumt sich in seinen Allmachtsphantasien schließlich in die Rolle des Beraters des Virus hinein. Er will für noch mehr Kahlschlag, für noch mehr Leere sorgen, noch mehr Rache nehmen. In seinem Delirium verliert er so sehr die Kontrolle über sich, dass er sich am Ende sogar selbst für das Virus hält. Mit aufgerissenen Augen rückt er ganz nah an die Kamera heran und haucht einen Schwall Aerosole auf die Linse, bis sie beschlägt.
Die von Resi-Hausregisseurin Nora Schlocker eingerichtete „Superspreader“-Inszenierung rückt in dieser Schluss-Szene den Zuschauer*innen zum ersten Mal auf die Pelle. Ansonsten bleibt sie doch ein theatraler Monolog, der sich distanziert betrachten lässt. Die Interaktion mit dem Publikum und die Chancen des Digitaltheaters via Zoom nutzt der „Superspreader“ nicht, obwohl sich dies gerade bei dem intimen Rahmen von nur 15 Teilnehmer*innen anböte.
Florian Jahr zeigte sich beim Nachgespräch etwas enttäuscht, dass die Zuschauer*innen von sich aus keinen Versuch machten, in die Performance einzugreifen. Es gab aber von Regisseurin und Spieler keinerlei Signale, dass das erwünscht ist, oder Anreize, dies zu tun.
Weiterlesen