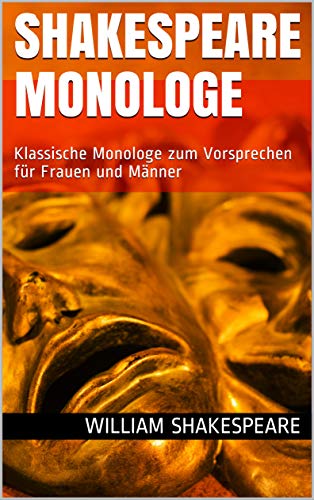Heute ist zweiter Weihnachtstag 2019, und da passt es, rückblickend etwas zu den beeindruckenden, ausgezeichneten Kempowski-Aufführungen im Altonaer Theater im Herbst 2019 zu schreiben, bevor die Erlebnisse ganz zu einem Gesamteindruck der Erinnerung verschmelzen.
Ich bedanke mich allerherzlichst beim Regisseur Axel Schneider für die Aufführungen, die mich sehr angesprochen und berührt haben.
Zu Anfang der Aufführung dachte ich: „Na, klappt das mit dem Erzähler?“; aber nach zwanzig Minuten konnte ich zustimmen: „Ja, es klappt“; was nicht selbstverständlich ist. Aber es fiel leicht, dem Hauptdarsteller als Walter Kempowski zuzustimmen, er war dem wirklichen Autor ähnlich, mit Händen in den Taschen; und schon das Vorstellen des Chronik-Buchpakets hätte dem wirklichen Kempowski gefallen. Der war schon stolz auf sein Werk, und das völlig zu Recht.
Ich glaube, ich war von den Aufführungen emotional angesprochen, weil Kempowski Bücher über die alltägliche Lebenswelt geschrieben hat, die bürgerliche Lebenswelt, wie er so gerne sagte. Roberts Spiel mit dem Jojo erinnert an eigene ähnliche Spiele am selben Ort in der Sonne. Bei den Aufführungen erinnert man sich nicht nur an seine Kempowski-Leseerlebnisse, sondern auch an begleitende Erfahrungen aus dem eigenen Leben. Dies ist literarische Schönheit, von der Schiller noch nichts geahnt hat, Lessing selbstverständlich ja (Lebensnähe, Unterhaltsamkeit, Komödiantisches, Witz und … Ernst). Ein Pastor in der gestrigen Predigt vom 1. Weihnachtstag sagte sinngemäß: „Schriftsteller fassen die Lebenserfahrungen der Menschen in knappen Worten zusammen“. Ein Gedanke, der zu Kempowskis Art des Schreibens gut passt.
Die Grundaussage der Aufführungen floss für mich in der Tanzszene von „Tadellöser & Wolff“ zusammen, als die Zeit des Krieges herrschte, aber eine Jazzplatte aufgelegt wurde und zu Artie Shaws „Goody, goody“ gesungen und vor allem getanzt wurde: Walter, Robert, Heini Schneefoot, die Mutter, die ganze private Welt, die die Schnauze voll von Krieg und Gewalt hat. Aber es tanzte nicht nur Schneiders Konzept, die Botschaft. Auch die wirklichen Schauspieler (!) tanzten, für die Freiheit, die Ungezwungenheit, das Aufbäumen gegen den Krieg und Nazis, und sie tanzten für die Zuschauer. Es war unglaublich im besten Sinne. Allein für diese Szene muss das Einüben der Choreographie Wochen gedauert haben.
Das Plädoyer für die Freiheit wurde in der dritten Aufführung auf direkte Weise deutlich. Walter leidet in der Haft, ist komplett unbekleidet und wird mit kaltem Wasser übergossen. Da bleibt es bei keinem stellvertretenden Leiden, wie der wirkliche Walter Kempowski im Romantext versucht hat, sich einen Sinn der Haft begreifbar zu machen. Er selbst hat gelitten, als einzelner unter dem Zwang des verantwortlichen Regimes, der ausführenden Gefängnis-Mitarbeiter – und dann, mitten in diesem Gewalt-Wahnsinn findet ein russischer Aufseher ein warmes Wort: „Walterra“. Das ist die Ambivalenz in Kempowskis Dichtung, die Axel Schneider ausgezeichnet zu einem Grundkonzept seines Arrangements gemacht hat. Auch der Darsteller Johan Richter als Walter hat auf der Bühne gelitten, in Echtzeit, wie man heute sagt, ich hoffe, das Wasser war nicht kalt. Seine emotionale Erlösung am Schluss des Stücks war groß, wegen der ergreifenden Szene am Taxi nach der Entlassung („Das ist ja direkt erschütternd“), aber auch wegen des Überstehens der Kälte auf der Theaterbühne.
Die Ambivalenz wurde bei der NS-Thematik sehr deutlich und auf angemessene Weise umgesetzt. Auf eine unbedachte judenfeindliche Äußerung der Mutter folgt prompt eine Szene, die die Judenfeindlichkeit des NS-Regimes aufzeigt und entlarvt. Sogleich ist die Mutter über die eigene Herabsetzung schockiert und mit ihr der Zuschauer. Vereinnahmung für irgendwelche politischen rechten oder auch linken Seilschaften ist dadurch ausgeschlossen. Diese Konterkarierung, die sich in Kempowskis Werken findet, wurde von Axel Schneider sehr konsequent umgesetzt.
Bei „Ein Kapitel für sich“ überzeugten der Ernst der Gefängnis-Wirklichkeit im Wechsel mit bürgerlichen Szenen aus dem Roman „Herzlich willkommen“, wobei es nur bedingt überzeugend war, dass Verwandte, die zunächst Ressentiments gegen Walter hatten, dann neutral bis warmherzig – z.B. über Informationen aus der Haftzeit – berichteten. Aber als dramaturgischer Griff ist das erklärbar und in Ordnung.
Trotz der glaubwürdig ernsthaften Darstellung der Misshandlung Walters im Gefängnis hätte ich gern Walters innere Gedanken, Wünsche und Vorstellungen in der Einzelhaft szenisch umgesetzt gesehen. Seine erdachte UNO-Rede, der Spaziergang mit der Gutsbesitzer-Tochter und der Rückerhalt einer Uhr vom Uhrmacher sind Romanpassagen, die meinen Zugang zu Kempowski entscheidend geprägt haben. Vielleicht hätte in diesen Szenen hierfür ein zweiter Darsteller dienen können.
Die ganze Bedeutsamkeit der oben angesprochenen Tanz-Szene aus „T&W“ wurde für mich deutlich, als Robert in „Uns geht´s ja noch gold“ am Essenstisch sagt: „Ich habe keine Freunde mehr“, alle sind im Krieg gefallen. Zu „Goody, goody“ hatte Heini Schneefoot noch mitgetanzt.
Sehr beeindruckend war die Gesangs-Einlage von Katrin Gerken als russische Künstlerin im Tanz-Café von „Ein Kapitel für sich“ (Roman: „Uns geht´s ja noch gold“). Man hätte gerne applaudiert (ich habe es ein bisschen), aber – in diesem Fall leider – ging es gleich konterkarierend weiter. Katrin Gerken hätte in „Aus großer Zeit“ die Rolle der Großmutter Anna übernehmen können, ganz einfach, weil sie der wirklichen Anna Kempowski recht ähnlich sieht (siehe Foto im „Sirius-Tagebuch“). Beeindruckend waren die Rollenwechsel von Tobias Dürr: plötzlich kommt er als glaubwürdig-andächtiger Gottesdienstbesucher in den Saal.
Am Schluss der „T&W“-Aufführung schien Johan Richter nicht ganz zufrieden. Hatten Nuancen geholpert? (Darbietung seiner etwas überlang konzipierten Abschluss Erzählung? Hatte die Darstellerin der Mutter zu häufig rückwärts gewandt gesprochen?). An allen übrigen Tagen war jedenfalls alles bestens und die Schauspieler am Schluss begeistert.
Als Kontrapunkt zum Gefängnis-Leid in „Ein Kapitel für sich“ war das Abschluss-Treffen der ganzen Familienmitglieder auf der Burg emotional-nahegehend, versöhnend und ein Mehrfach-Happy-End. Das Versöhnliche des Burgtreffens wurde im Vergleich zum Roman stärker, beeindruckend herausgestellt. Witzig war Sörensens Nachfrage bezüglich einer möglichen Entschädigung, das hätte auch Lessing wieder gefallen und – hoffentlich – vor ihm bestanden.
Ich bedanke mich noch einmal beim Macher des Ganzen und den Schauspielern, vor allem dem Walter Kempowski Johan Richter, der das alles ganz toll gemacht hat und ein Vertrauter auf der Bühne wurde. Danke auch an Anne Schieber für das Spielen der Mutter und, ich gebe zu, für das charmante Schauspiel von Nadja Wünsche als junge Grethe, Ulla und Christa.
Zum Inhalt: Ein Merkmal der Spielzeit ist der intensive Blick auf das 20. Jahrhundert und wie dieses erinnert wird. In vier Theaterabenden wird Walter Kempowskis Romanzyklus Deutsche Chronik auf die Bühne gebracht. Die Reihe, zwischen 1971 und 1984 veröffentlicht, umfasst neun Bände. Kempowski (1929–2007) erzählt darin den Niedergang des deutschen Bürgertums während des 20. Jahrhunderts und benutzt dafür in einer Mischung aus Dokumentation und Fiktion seine eigene Familiengeschichte.