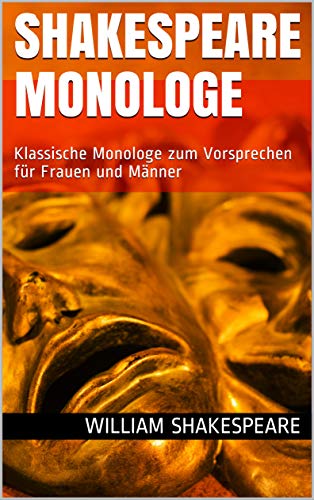Rezension zu „Elektra – Ein Familienalbum von Rieke Süsskow“ am Berliner Ensemble, Premiere am 22. Oktober 2020...
von: www.theatrumvinum.blog
„Erst wars vorher, dann wars vorbei – dazwischen hab ich nichts getan.“
Hugo von Hofmannsthal, [i]Elektra[/i]
In seiner Erzählung [i]Über das Marionettentheater [/i]aus dem Jahr 1810 beschreibt Heinrich von Kleist die Marionette als den Gesetzen der Mechanik unterlegen, sie ist der menschlichen Individualität enthoben und dem „Maschinisten“ gänzlich ausgeliefert. Die Marionette habe deshalb jedoch mehr Anmut und Grazie als der Schauspieler, weil bei ihr der Ausdruck des Körpers „gänzlich ins Reich mechanischer Kräfte“ hinüber spiele und der „Maschinist“ habe nur nur jeweils den Schwerpunkt der Marionette zu verändern, um eine tänzerische Bewegung auszuführen, denn jede Bewegung habe „einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, in dem Innern der Figur, zu regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgend ein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst.“ Insofern besitzt sie Kleist zufolge den Vorteil, dass sie sich nicht „ziert“, womit er meint, daß die Marionette über kein reflektierendes Bewußtsein verfügt und sich folglich auch nicht über den Riß zwischen eigener Persönlichkeit und eigenem Körper bewußt sein kann, keine Eitelkeit besitzt: „Denn Ziererei erscheint …, wenn sich die Seele (vis motrix) in irgend einem andern Punkte befindet, als in dem Schwerpunkt der Bewegung. (…) Wir sehen, daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt.“ Insofern auch sei die Marionette – und das ist von Kleist sicherlich auch satirisch gemeint – die ideale Verkörperung von Theatralität: Nur die Marionette verfügt über keine Existenz außerhalb des Theaters.
Die Grazie der Marionette ist ohne innere Substanz, eine reine Wirkungsästhetik. In ihr kommt keine Seele zum Ausdruck, gar nichts. Sie verkörpert vielmehr die vollkommene Kontrolle, unter der sie steht: Sie ist in diesem Verständnis dem Schicksal ergeben. Und „aufgehängt am eigenen Schicksal“, wie Karolin Trachte im Programmheft schreibt, sind auch die Figuren in „Elektra – ein Familienalbum von Rieke Süsskow“ am Berliner Ensemble. Denn Süsskow inszeniert das vermeintliche Seelendrama um Elektra als eine Art Marionettentheater, in der die Figuren als völlig entmenschlichte und unpersönliche Gestalten dargestellt sind, der Geschichte ausgeliefert wie ferngesteuerte Automaten.
Zu diesem stilistischen Verfremdungseffekt tritt ein weiterer, denn die Geschichte über die Atriden, die verfluchte Familie Agamemnons, wird auf einer Bühne inszeniert, die von Marlene Lockemann als ein überdimensionales, aufklappbares Pop-up-Kinderbuch aus Pappkartonwänden gestaltet ist, die wie Buchseiten umgeblättert werden und so verschiedene Räume im Hause Agamemnons und Klytemnästras zeigen, sowie in einer Szene mit Elektras Bruder Orest auch eine Schlange (als Verweis auf das Orakel von Delphi, vor das Orest der Sage zufolge tritt? Schließlich wurde das Orakel von dem aus einem Seitensprung von Zeus entsprungenen Sohn Apoll an dem Ort errichtet, an dem er die von der eifersüchtigen Hera geschickte Python erschlug, weshalb die delphische Priesterin auch Pythia genannt wurde).
Dieser Bilderbuch-Idee setzt Süsskow in der Inszenierung fort, denn die Tragödie um Elektra spielt sich pantomimisch ab beziehungsweise wird von ihr nur optisch umgesetzt; Das Rachedrama wird über das Visuelle erarbeitet und spielt sich völlig wortlos ab, auf Sprache wird verzichtet. Stattdessen wird die Geschichte in expressionistischen Gesten und Bildern entfaltet. Bildhaft gesprochen, blättert Süsskow im Familienalbum – und greift dabei auf eine Ästhetik zurück, die dem Horror-Stummfilm der 1920er-Jahre gleicht, in dem die extrem überzeichneten und grotesken Figuren in ihren körperlichen Verrenkungen wie ferngesteuert agieren. Dazu passt auch die musikalische Live-Begleitung und dramatische, spannungsgeladene Untermalung der einzelnen Szenen und Bewegungsabläufe (Sven Kaiser).
Die Pappkulisse ist bunt ausgeleuchtet wie in einem Märchen, die Idylle allerdings ist eine trügerische, denn aufgeführt wird eher ein Anti-Familienidyll: die mörderische Geschichte des Hauses der Atriden, das von Süsskow allerdings nicht als ein psychologisches Drama inszeniert wird. Schon Elektras Schwester Iphigenie (Aleksandra Corovic) wird allein deshalb zum Mordopfer ihres Vaters Agamemnon (Tilo Nest), weil sich dessen Hand quasi verselbständigt. Der Mord erfolgt völlig unmotiviert: die Hand erwürgt Iphigenie rein mechanisch, losgelöst von Zwang oder Wille. So verabschiedet sich Süsskow auch vom Mythos: Dort vollzieht Agamemnon ein zwar grausames, aber rituelles Opfer an Iphigenie, um in den Krieg gegen Troja ziehen zu können. Das wird seine Frau Klytämnestra (Kathrin Wehlisch) zehn Jahre später mit Hilfe ihres Liebhabers Aigisth (Oliver Kraushaar) rächen, indem sie den heimgekehrten Gatten im Bad mit einem Beil erschlägt – das ihr bei Süsskow in einer gelungenen Szene von der als Gespenst erscheinenden Iphigenie gereicht wird –, was wiederum Elektra (Laura Balzer) auf den Plan bringt, diesen Mord mit Hilfe ihres Bruders Orest (Nico Holonics) zu rächen, dem der Muttermord sogar vom delphischen Orakel geraten wird. So wiederholt sich im Mythos das Trauma, die Gewalt und Rache von Generation zu Generation. Jeweils aufs Neue wird Schuld auf sich geladen – das ist der Fluch, der auf den Atriden lastet.
Diese antike Orestie ist in Süsskows Regie höchstens noch zu erahnen. Gewalt wird bei ihr auf keine Quelle mehr zurückgeführt, sondern ist omnipräsent als eine Art „fremde Gewalt“, die sich der Körper der sechs SchauspielerInnen bemächtigt und zurichtet. Ihre mechanischen Bewegungen sind abgehackt und eckig oder ins Groteske überzeichnet, ihre Gesten verrenkt, ihre Münder aufgerissen und ihre Gesichter verzerrt (das Leid nur schwer zu erkennen). Manchmal bewegen sich ihre Lippen, aber es dringt kein Wortlaut nach Außen, sie bleiben in ihrer stummen, gestischen Bilderwelt gefangen – wie auch in der ewigen, mechanischen Wiederholung des unaussprechlichen Traumas. Entsprechend endet das Stück, wie es begonnen hat: Elektra, die einzige Überlebende des Dramas, verharrt zunächst in grotesker Verrenkung (als ob sie „in den Seilen“ hängt, oder an Ketten?), bevor sie das Familienalbum hinter sich schließt, so, wie sie es am Anfang öffnete.
Aber nur scheinbar geht die bildhafte Form bei Süsskow über den wortlosen Inhalt. Denn sie zeigt in ihrer Inszenierung des Elektra-Stoffes gewissermaßen die im Mythos inhärente „strukturelle Gewalttätigkeit der westlichen zivilisatorischen Ordnung“ (wie sie selbst in Hinblick auf ihre letztjährige Hamburger Medea-Inszenierung sagt) in der Art eines Marionettentheaters, das hier zu einer Art „Unterdrückungsmaschine“ wird. Bei Süsskow erscheint das Individuum als Marionette, als bewusstloses Anhängsel der Geschichte – so wie bei Karl Marx der Mensch in der Fabrik der Maschine als Anhängels einverleibt ist. Elektras Rache erhält so etwas mechanisches, unreflektiertes und sinnloses – es gelingt ihr nicht aus dieser ewigen Wiederkehr auszubrechen. Sie bleibt stumm, gefangen am Gängelband der Geschichte quasi.
Einen Ausweg jedoch aus diesem Gefängnis zeigt zumindest Aischylos: Seine Orestie endet mit einer Gerichtsverhandlung auf dem Areopag in Athen, auf der Orest von der Schuld des Muttermordes entsühnt und von der Tyrannei und Verfolgung durch die Erynnien, der Rachegeister, befreit wird. Es ist das erste bürgerliche Gericht der Geschichte – der demokratische Vorläufer in der Antike, auf der das Individuum im wahrsten Sinn des Wortes, seine [i]Stimme[/i] findet (auch wenn Orest nach bürgerlicher Stimmengleichheit letztlich von Athene freigesprochen wird). Und wünscht man sich denn nicht gerade heute, am Vortag der amerikanischen Präsidentschaftswahl, umso mehr, dass sich der Mensch wieder seiner selbst bemächtigt und seine Stimme findet? Nicht dass es später heißt: „Erst wars vorher, dann wars vorbei – dazwischen hab ich nichts getan“ …
Rieke Süsskow wurde 1990 in Berlin geboren und studierte zunächst Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien. 2014-2019 studierte sie Regie an der Theaterakademie in Hamburg. Während des Studiums wurde sie Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und gewann gemeinsam mit Emre Akal für die Uraufführung [i]Heimat in Dosen [/i]den Jurypreis des 10. Nachwuchswettbewerbs. Ihre Abschlussinszenierung [i]Medea [/i]nach Motiven von Hans Henny Jahnn hatte im März 2019 Premiere auf Kampnagel und wurde zum Fast Forward Festival des Staatsschauspiel Dresden und dem FIAT Festival in Montenegro eingeladen. Dort gewann sie den Preis für die beste Regie. Ihre Uraufführung von Kevin Rittbergers [i]IKI.radikalmensch [/i]am Theater Osnabrück wurde zu den Mühlheimer Theatertagen 2020 sowie zum Festival Radikal Jung am Münchner Volkstheater eingeladen.
 TICKETS ONLINE KAUFEN
TICKETS ONLINE KAUFEN