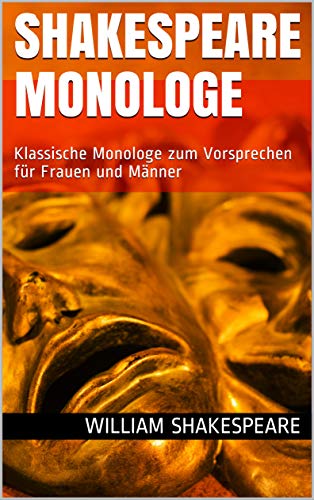Erich Wolfgang Korngolds Opus 20 „Das Wunder der Heliane“ hatte seit der Hamburger Uraufführung 1927 weitaus geringeren Erfolg als seine 1920 vorgestellte Oper „Die tote Stadt“. Immerhin gab es 1928 eine „Heliane“-Aufführung unter Bruno Walter in der Städtischen Oper Berlin, der heutigen Deutschen Oper Berlin. Nimmt man hinzu, dass dort 1983 eine Inszenierung der „toten Stadt“ vom damaligen Intendanten Götz Friedrich zu sehen war, kann man davon sprechen, dass Korngolds Werke in diesem Hause stets eine besondere Aufmerksamkeit gefunden haben. Gleichwohl ist diese Aufführung der „Heliane“ eine reizvolle Rarität, die beim internationalen Opernpublikum entsprechende Resonanz findet.
Der Kern der Handlung im Libretto von Hans Müller-Einigen ist ein im Grunde pubertärer Eifersuchtskonflikt, an dessen Kulminationspunkt das titelgebende „Wunder“ steht. Der Text mit seiner gestelzten, bisweilen gewollt überhöhten Kunstsprache atmet diesen rührenden, emphatischen Weltverbesserungsgeist mancher Autoren der Zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der in den Dreissigern von der Geschichte dann so markant konterkariert und in der Weltkriegs-Katastrophe der Vierziger unwiderruflich zuschanden geritten wurde. Die Gratwanderung zwischen äusserster Stilisierung und purem Kitsch führt dabei auch zu gelegentlichen Grenzüberschreitungen.
Regisseur Christof Loy erreicht an diesem Abend zwei widerstreitende Ziele: Er erzählt ohne Stilbruch einen durchaus spannenden Krimi und erreicht gleichzeitig eine bewegende Verklärung der Liebe. Seine Szene (von Johannes Leiacker) ist drei Akte lang ein repräsentativer, holzgetäfelter Gerichtssaal, in dessen Vordergrund lediglich ein schmaler Tisch und ein Stuhl stehen.
Ein wesentlicher Vorzug von Christoph Loys Inszenierung besteht in der Fähigkeit des Regisseurs, die Spannungen zwischen den handelnden Personen ebenso zwingend und unausweichlich dazustellen, wie er später im dritten Akt die Interaktionen zwischen Einzelpersonen und Gruppen des hereindrängenden Volkes fesselnd und bruchlos wiedergibt. Gleichrangig steht daneben die sorgfältige Einstudierung der Chöre durch Jeremy Bines.
Der Herrscher eines totalitären Staates (Josef Wagner), dessen grausame und gemütskalte Haltung sich längst auf sein Volk übertragen hat, will einen Fremden (Brian Jagde) am nächsten Morgen hinrichten lassen, dessen aufgeschlossenes Wesen den Geist von Widerspruch und Rebellion verbreitet. Königin Heliane (Sara Jakubiak) hat sich ihrem Ehegatten bislang verweigert und kommt nun zu dem Fremden ins Gefängnis, um ihn zu trösten. Beide kommen sich rasch näher, und aus Wesensverwandtschaft entsteht Liebe. Diese geheimnisvolle Verbindung ist enger, als es die Beziehung zwischen König und Königin je gewesen ist. Gleichwohl sieht sich Heliane, vor Gericht gestellt, weder als Dirne noch als Ehebrecherin. Der Fremde begeht Selbstmord mit einem Dolch, den Heliane zuvor von ihrem rasend wütenden Gatten bekommen hat. Der verlangt nun von seiner Frau, sie solle als Unschuldsbeweis den Selbstmörder wieder zum Leben erwecken. Als Heliane tief zerknirscht ihre wahre Schuld bekennt, den Fremden wirklich geliebt zu haben, geschieht das Wunder: Der Fremde erhebt sich von seiner Bahre, rühmt in beredten Worten Freiheit und Liebe, um dann gemeinsam mit Heliane, von Licht umflossen, der Zukunft entgegenzugehen.
Der zweite Vorzug dieser Inszenierung liegt in der darstellerisch wie stimmlich treffenden Besetzung der Solistenrollen. Neben Heliane, dem Herrscher und dem Fremden ist hier der Pförtner von Derek Welton zu erwähnen, dessen Schilderung der Wunderheilung seines Kindes durch Heliane an den Bericht Jochanaans von den Wundertaten Jesu in Richard Strauss’ „Salome“ erinnert. Okka von der Damerau ist die stramme Botin, einst kurzzeitig die Geliebte des Königs und noch heute seine Parteigängerin. Burkhard Ulrich gibt sehr überzeugend den blinden Schwertrichter, der den Prozeß der Urteilsfindung leitet. Gideon Poppe ist ein bebrillter skeptischer junger Mann, der alle Vorgänge aufmerksam verfolgt.
Dirigent Marc Albrecht läßt diese Handlung aus dem Glutfluss der Korngold-Partitur aufsteigen. Sein eminenter Klangsinn, der auch gelegentlich überlaute Fortissimi nicht scheut, verbindet musikalische Charakterzüge von Wagner, Richard Strauss, Ravel und Eduard Künneke mit - ja eben, mit Korngold zu einer durchgehend faszinierenden Klangschmelze. Selten hat man das Orchester der Deutschen Oper Berlin so homogen, in sämtlichen Instrumentengruppen so organisch und ohne Fehl agieren hören.
Einhelliger, begeisterter Beifall für ein selten zu hörendes Werk, das wie eine Botschaft aus einer anderen Zeit wirkt.
http://roedigeronline.deZum Inhalt: Erich Wolfgang Korngold sprach von seinem „Meisterwerk“: DAS WUNDER DER HELIANE fasst alles zusammen, was das Musiktheater Korngolds ausmacht – und geht in den Dimensionen noch einen Schritt darüber hinaus: eine riesige Partitur und Orchesterbesetzung, rauschhaftes Pathos und hochexpressive Harmonien, die mit den schillernden Farben der Polytonalität spielen – eine Musik von packender Dramatik und großer Sinnlichkeit. Die Hamburger Uraufführung 1927 war erfolgreich und über ein Dutzend weiterer Häuser setzten das neueste Werk des damals neben Richard Strauss meistgespielten Opernkomponisten auf ihre Spielpläne. So auch 1928 die Städtische Oper Berlin unter Bruno Walter, doch hier, wie auch an anderen Orten, blieb die Anerkennung aus: Intrigen spielten eine Rolle, aber auch der Vorwurf, mit dieser spätromantischen Partitur aus der Zeit gefallen zu sein. Mit dem von den Nazis verhängten Aufführungsverbot des jüdischen Korngold verschwand DAS WUNDER DER HELIANE gänzlich aus dem Repertoire – bis zum heutigen Tag. Die Geschichte vom eiskalten Herrscher ohne Liebesfähigkeit, dessen Frau Heliane, die sich einem dionysischen Fremden hingibt, und einem Volk, das auf ein erlösendes Wunder wartet, ist märchenhaft und zeitlos.