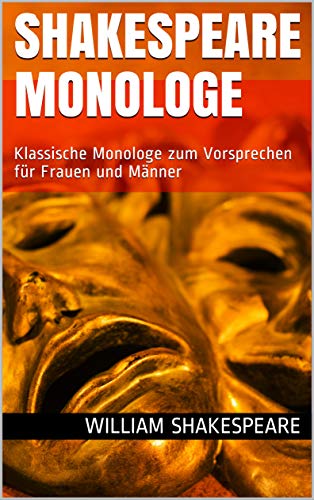Sie ist ein Kuriosum in der Opernliteratur, George Bizets 1875 in der Pariser Opéra Comique uraufgeführte Oper „Carmen“. Die Erstvorstellung war ein Misserfolg. Zwei Monate später starb der Komponist und konnte nicht mehr miterleben, wie sich das Schicksal wendete und aus seiner Oper jener Welterfolg wurde, der das Werk bis heute auf Spitzenplätzen des internationalen Musiktheaters hält, ganz zu schweigen von den vielen Adaptionen im Film und auf der Schallplatte. Das Publikum hatte anfangs diese „Opéra comique“ abgelehnt, deren realistische Darstellung und unausweichliche Tragik sie entgegen der Tradition eher zu einem Vorläufer des „Verismo“ werden liess. Der Einstellungswandel in den folgenden Jahren rückte die Frauenfigur der Carmen mit ihrem unbändigen Freiheitsdrang und ihrem Beharren auf dem Primat der Empfindung in den Vordergrund, und auf einmal wurde daraus ein frühes Paradigma weiblicher Emanzipation.
Der norwegische Regisseur Ole Anders Tandberg, durch erfolgreiche Inszenierungen wie die „Lady Macbeth von Mzensk“ 2015 in diesem Hause legitimiert, hat sich zweifellos mit der Vorlage, der Novelle von Prosper Mérimée und dem Libretto von Meilhac und Halévy eingehend beschäftigt. Leider hat er daraus die falschen Schlüsse gezogen. Die Annahme, dass der Opernregisseur unserer Tage dem Publikum die notfalls gewaltsame Herstellung aktueller Zeitbezüge schulde, beruht auf einem Missverständnis und führt ins Abseits. Was hier bewiesen wird.
Das beginnt bei der Hauptfigur. Diese Carmen ist bei ihm einfach ein junges Mädchen in leuchtend roter Robe, das auf dem Recht der freien Wahl ihrer Liebhaber bis zum verderblichen Ende besteht. Von der unterschwelligen Dämonie dieser Figur, ihrer geheimnisvollen Neigung zu okkulten Riten, ihren dunklen Ahnungen und ihrem Fatalismus bleibt kaum etwas übrig. Stattdessen installiert er sexuelle Vergröberungen wie in den Soldatenszenen und läßt Escamillo die Hoden eines getöteten Kampfstiers entfernen, die er anschliessend der gefaßt reagierenden Carmen als Liebesgabe dediziert, was auf offener Szene die ersten Unmutsäußerungen des Publikums provoziert. Leutnant Zuniga muss sich die Entfernung seiner Nieren gefallen lassen, und im dritten Akt spielen Carmen, Frasquita und Mercédès nicht etwa Karten, sondern sie sortieren extrahierte Herzen aus Petrischalen in Thermobehälter - die Schmuggler entnehmen nämlich geeigneten Opfern gewaltsam die kostbaren Spenderorgane, mit denen sie dann einen schwunghaften Handel treiben. Andere szenische Details wie die Auftritte von Kindern, die Leuchtkugeln in Händen halten, oder die mehrfachen Trippelschritt-Paraden schwarzgekleideter Mantilla-Trägerinnen mit Handtasche bleiben, abgesehen vom optischen Reiz, ohne sinnfällige Verbindung zur Handlung.
Das Bühnenbild von Erlend Birkeland ist ebenso simpel wie praktisch: ein hoch aufragendes, auf die Drehbühne gestelltes Amphitheater, dessen Rückwand gleich als Dekor für die auf der Vorderbühne spielenden Szenen dient.
Das Paradox der Aufführung besteht darin, dass sie musikalisch ziemlich nahe an die absolute Erfüllung heranreicht. Die Carmen mit dem Mezzo von Clémentine Margaine lässt stimmlich keine Wünsche offen. Charles Castronovo absolviert sein Rollendebüt als Don José mit Auszeichnung und erreicht in der Schlusszene mit Carmen eine stimmliche und darstellerische Intensität, die kaum zu übertreffen ist. Tobias Kehrers Leutnant Zuniga fesselt mit wohlfundiertem Baß, und bei den Damen sind dIe Frasquita von Nicole Haslett und die Mercédès von Jana Kurucová auch kostümlich reizvolle Carmen-Doubletten. Als Micaëla, die verschmähte Partnerin des Don José findet Heidi Stober ebenso nachdenkliche wie leidenschaftliche Töne. Marcus Brück gibt dem Stierkämpfer Escamillo mit dem Torerolied das wuchtige Profil, wobei die Stimme in den tiefen Lagen etwas matt klingt. Ya-Chung Huang als Remendado und der elegant-bewegliche Dean Murphy als Dancairo mischen das Schmugglermilieu etwas in Richtung „Opéra comique“ auf. Die Chöre sind mit Sorgfalt und feiner Klangabstimmung einstudiert. Ivan Repušić am Pult des Orchesters der Deutschen Oper leitet sein Ensemble eingangs etwas knallig, hat aber auch das nötige Feingefühl für die leiseren und die solistischen Passagen von Bizets Partitur.
Viel Beifall zum Schluß für Solisten, Chor und Orchester. Und kräftige Buhrufe für den Regisseur samt Team.
http://roedigeronline.de KARTEN ONLINE BESTELLEN
KARTEN ONLINE BESTELLENZum Inhalt: Mit seiner CARMEN schrieb Georges Bizet eine Kampfansage an die romantische Oper: Mit ihrem unbeugsamen Freiheitswillen verkörpert die Titelheldin das Gegenbild zu den passiven, leidenden Frauenfiguren, die zuvor die Opernbühne beherrscht hatten. Doch antiromantisch ist CARMEN in einem noch umfassenderen Sinn: Bizets Oper zeigt eine Welt, in der Liebe als zwischenmenschliches Gefühl keinen Platz mehr hat und längst durch Sex und Gewalt abgelöst wurde. Carmen und der Torero Escamillo sind Repräsentanten dieser Gesellschaft, in der nur noch das Recht des Stärkeren zählt. Eine Welt, in der Don José mit seinem bürgerlichen Ideal von Liebe ein Fremdling bleibt, der zum Scheitern verurteilt ist . Mit diesem illusionslosen Blick auf die Trostlosigkeit der menschlichen Existenz steht Bizet in unmittelbarer Nähe zu den Romanen eines Emile Zola – entgegen dem Klischeebild vieler Aufführungen ist Bizets Spanien ein Ort, der die Hässlichkeit der Armut in hellem Licht zeigt.