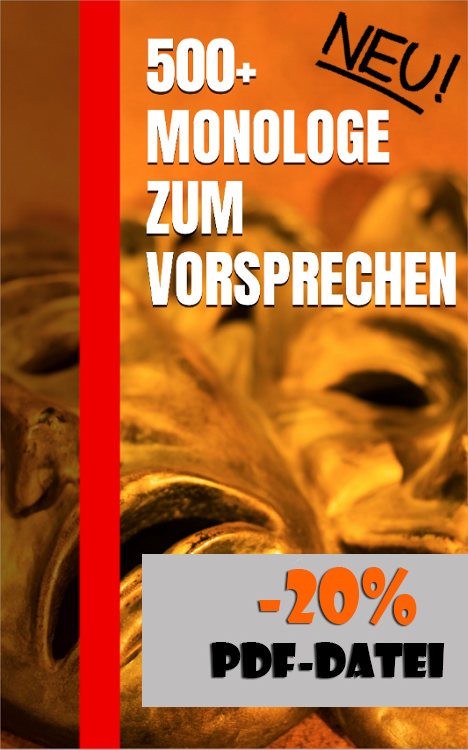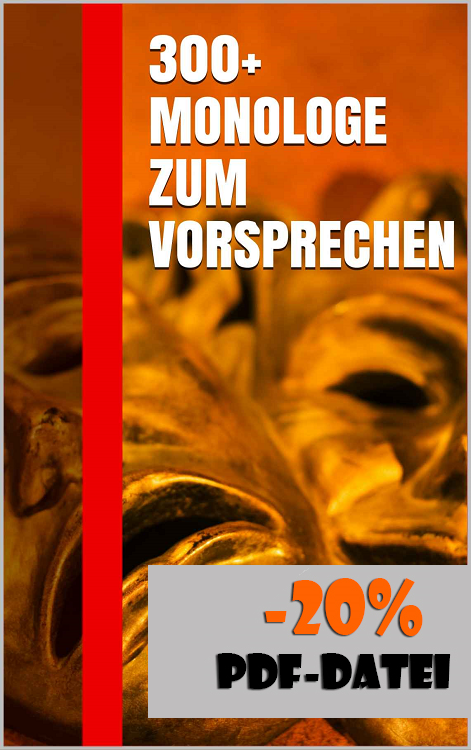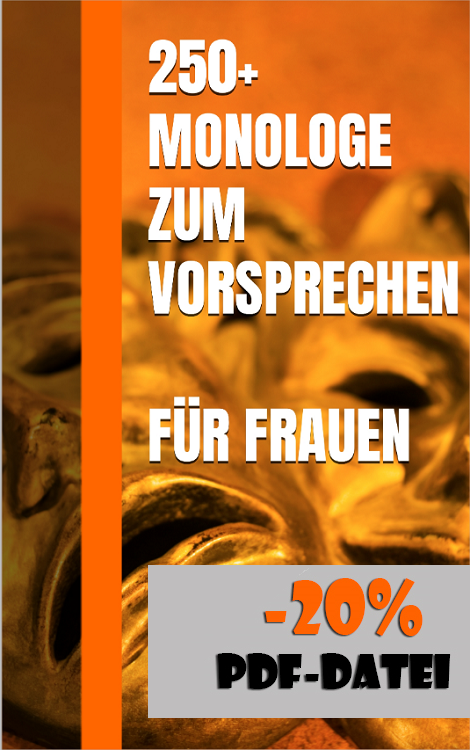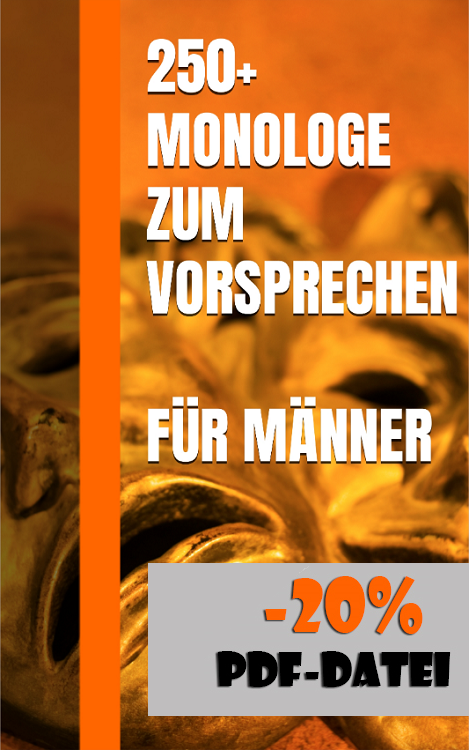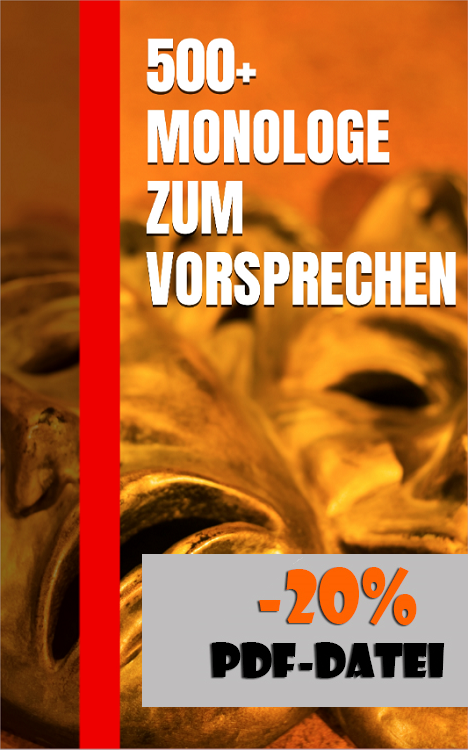Es hatte ein wechselvolles Schicksal, Heinrich von Kleists Drama „Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin“, im Jahre 1810 verfaßt und der preussischen Prinzessin Marianne gewidmet, die es aber wegen vermeintlicher Kränkung der Familienehre ablehnte, weshalb es dann erst 1821 in gekürzter Form uraufgeführt werden konnte. Gänzlich gegenläufig dann die Karriere des Dramas im „Dritten Reich“, wo besonders der Konflikt zwischen Befehl und Gehorsam herausgearbeitet wurde. Der Komponist Hans Werner Henze hat die Handlung zum Gegenstand seiner Oper „Der Prinz von Homburg“ gewählt, die 1960 uraufgeführt wurde. 2012 gab es eine von Publikum und Kritik sehr gelobte Inszenierung des Schauspiels bei den Salzburger Festspielen.
Der scheidende Intendant des „Berliner Ensembles“, Claus Peymann, hat das Drama nun als vorläufigen Abschluß seiner Berliner Bühnenpräsentationen in einer Neuinszenierung vorgestellt. Das Stück ist in seiner äusseren Gestalt nach Sprache und Aufbau zweifellos ein Klassiker, bietet aber im Rollenverhalten der dargestellten Charaktere sehr verschiedene Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten. Es wirkt in allererster Linie durch die Schönheit seiner Sprache, den Adel des dargestellten Konflikts und die Lebensnähe der handelnden Personen.
Achim Freyer baut dem Regisseur eine denkbar simple Bühne, die aus einer halbkreisförmigen Schräge besteht, auf der sich ein paar weiße Linien perspektivisch zum Hintergrund orientieren. Ein bläulicher Lichtstrahl ragt von dort in den Zuschauerraum hinauf, wie ein gedachter Pfad zu den Sternen. Schwarz herrscht vor, wird durch wechselnde Lichteffekte den einzelnen Szenen zugeordnet. Die Kostüme ebenfalls schwarz mit ein paar weißen Applikationen. Gelegentlich ergänzen rötlich flammende Projektionen den wuchtig vom Band tönenden Schlachtenlärm.
Brandenburgische Geschichte wird ins Gedächtnis gerufen. Vor der Schlacht von Fehrbellin beobachten preussische Offiziere zusammen mit ihrem Kurfürsten Friedrich Wilhelm (Roman Kaminski) kopfschüttelnd, wie der Kommandeur der Reiterei, Prinz Friedrich Arthur von Homburg (Sabin Tambrea) geistesabwesend und schlafwandlerisch vom Sieg in der nächsten Schlacht gegen die Schweden träumt und sich versonnen einen Lorbeerkranz flicht. Im Gespräch mit Graf Hohenzollern (Matthias Mosbach)schildert der Prinz seinen Traum. Dann folgt die Unterweisung der Offiziere mit der Maßgabe an Homburg, mit seiner Reiterei nicht früher loszupreschen, als er dazu einen ausdrücklichen Befehl erhält. In der Schlacht meint Homburg dann, seinen Kurfürsten bedroht zu sehen, eilt ihm befehlswidrig zur Hilfe und schlägt das schwedische Heer in die Flucht. Entgegen seiner Erwartung wird er vom geretteten Kurfürsten für diese Eigenmächtigkeit vors Kriegsgericht gestellt, das ihn zum Tode verurteilt. Homburg bittet erst die Kurfürstin (Swetlana Schönfeld), sich beim Kurfürsten für ihn zu verwenden, dann dessen Nichte Prinzessin Natalie von Oranien (Antonia Bill), die selbst ein Dragonerregiment führt. Natalie sucht den Kurfürsten auf, und der erklärt sich bereit, Homburg zu begnadigen, wenn der sich ungerecht behandelt fühlt. Ausgerechnet an dieser Bruchstelle scheitert der Begnadigungsplan, weil Homburg nach reiflicher Überlegung das Urteil für berechtigt hält und bereit ist, dafür in den Tod zu gehen.
Das Programmheft gibt verdienstvollerweise den gesamten Text des Dramas wieder, einschließlich aller Striche und Ergänzungen, die von der Regie vorgenommen wurden. Gleichwohl weicht die letzte Szene, der zehnte Auftritt im fünften Akt, von der Vorlage ab. Der berühmte Schlusssatz „In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!“ aus dem Munde des gesamten Offizierskorps wird schon viel früher gesprochen. Der Prinz von Homburg besteigt erneut traumverloren den Lichtstrahl zu den Sternen und stirbt im Kugelhagel. Anfang und Schluß sind Traumszenen.
Die Inszenierung hat unzweifelhafte Meriten. Die konstitutive Einheit von Ort, Zeit und Handlung bleibt durchgehend gewahrt, und die strenge Stilisierung in der Darstellung fördert die Konzentration auf das Wesentliche. Gleichwohl hätte man sich an manchen Stellen noch eine etwas eindringlichere Personengestaltung gewünscht, was vor allem durch die Sprachgestalt zu erreichen wäre. Den Publikumspreis für die geschlossenste Verbindung von Gestaltung und Artikulation erhält der wackere, strammbeinig hingestellte Oberst Kottwitz von Carmen-Maja Antoni. Auch von dem zu Recht bejubelten, feinsinnig sensiblen Sabin Tambrea in der Titelrolle wäre gerade in den lyrisch-poetischen Passagen noch etwas mehr vernehmliche Intensität ein Gewinn gewesen. Aber vielleicht bleibt dieser tragende sprachliche Ausdruck im Zeitalter von Mikroports und projiziertem Fließtext wirklich nur - ein Traum.
http://roedigeronline.de